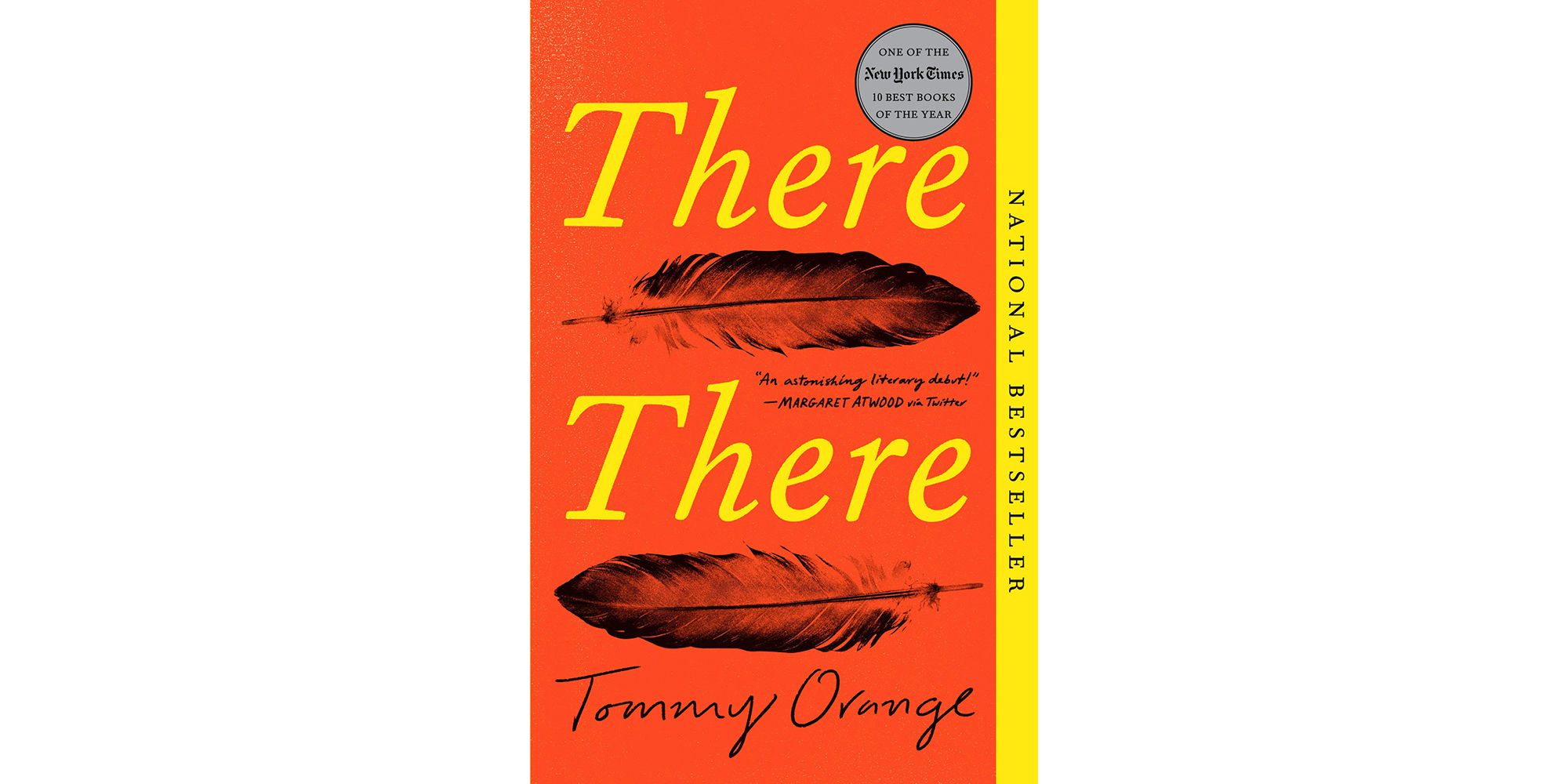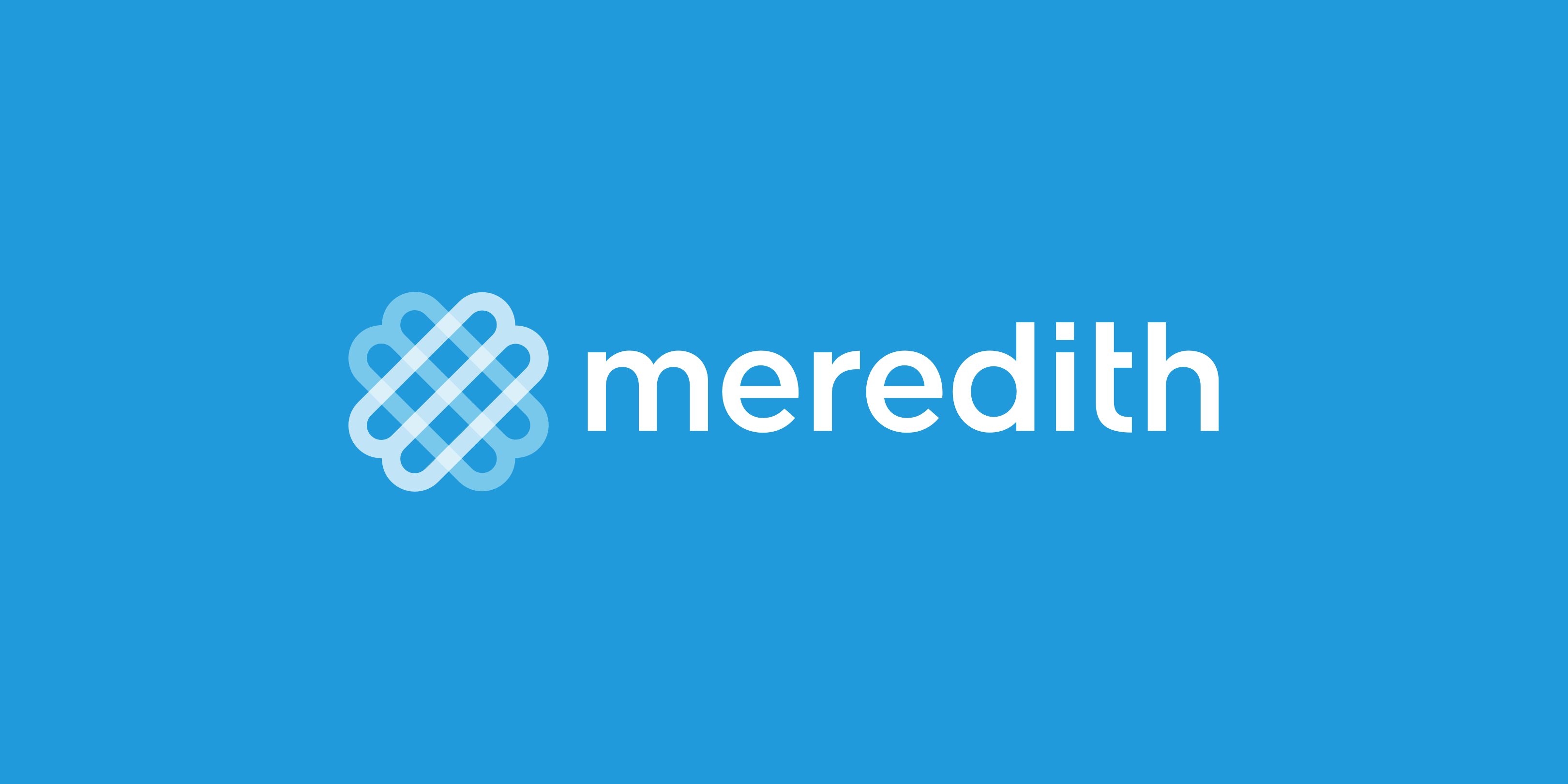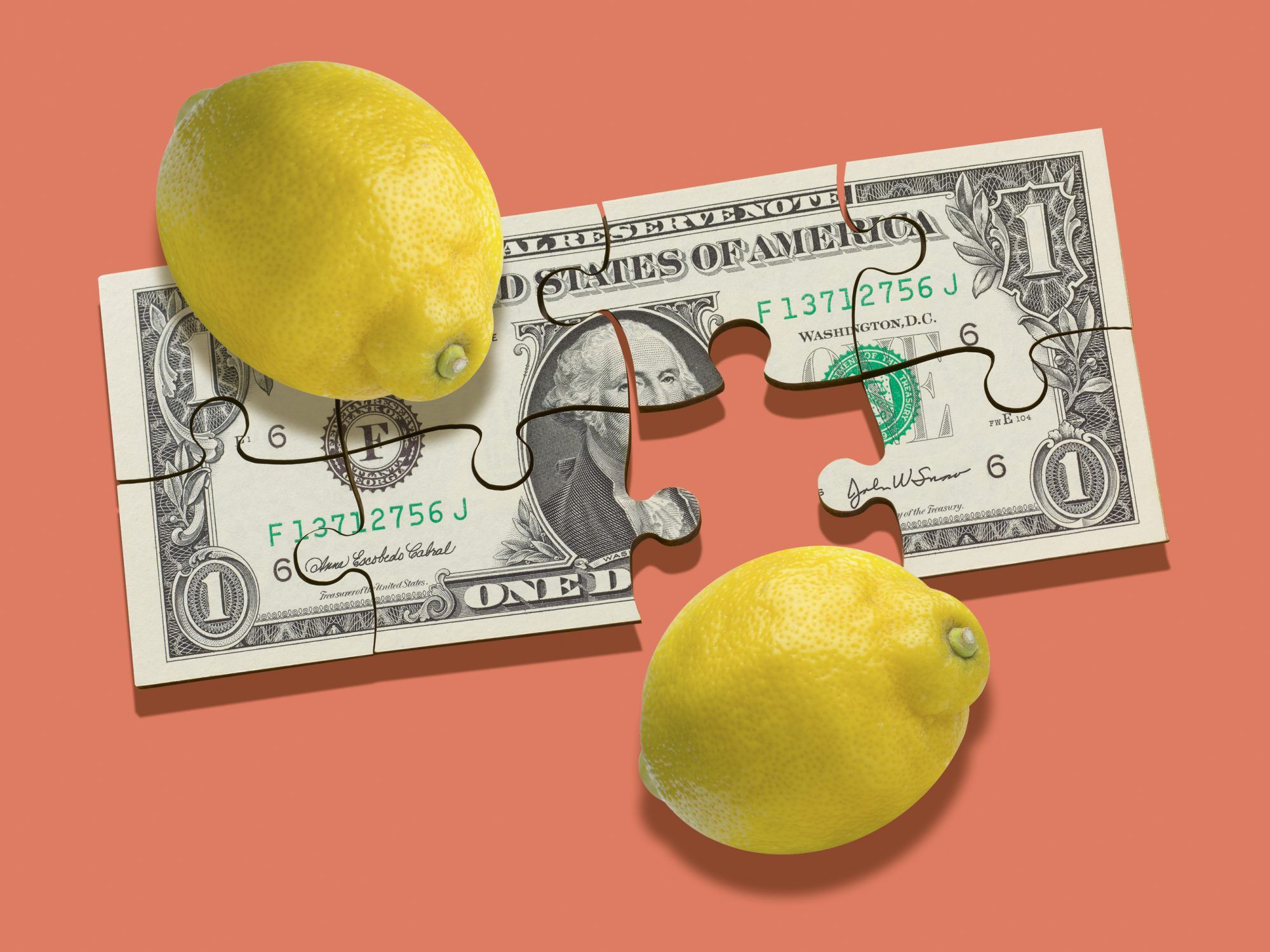Ich hatte sechs oder acht Mütter, je nachdem, wie fein die Definition ist, und obwohl die Frau, die mich geboren hat, nur eine Figur in dieser schwierigen Mischung ist, hat sie alles andere in Bewegung gesetzt und ist daher am größten. Ich war vier, als sie verschwand. Keine Notiz, kein tränenreicher Abschied, nur puff, sie war weg. Sie war 25 – eine junge 25 – und obwohl ich jetzt annehme, dass ihr Leben traurig, beängstigend und im Wesentlichen hoffnungslos war, konnten meine beiden Schwestern und ich zu der Zeit ihre Motive nicht ergründen. Wir starrten einfach in das schwarze Loch ihrer Abwesenheit.
In den nächsten anderthalb Jahrzehnten hüpften wir herum wie Flipper. Mein Vater war unzuverlässig – in und außerhalb von Schwierigkeiten, in und außerhalb des Gefängnisses – und so griffen andere ein. Wir blieben zuerst bei unserer Großmutter, dann bei einer alleinerziehenden Tante, und als sich niemand in unserer Familie auf unsere Langzeitarbeit verpflichten konnte Pflege wurden wir drei in das kalifornische Pflegesystem geschoben. Weil wir selten, wenn überhaupt, wussten, warum wir eine Situation verließen oder wo wir landen würden, wurden Verrenkung und Verwirrung zum Standard. Hilflos betraten wir fremde Häuser mit Müllsäcken voller Kleider.
Meine Schwestern (eine ältere, eine jüngere) und ich haben nie wirklich darüber gesprochen, was passiert ist. Ich für meinen Teil konzentrierte meine ganze Energie auf die perfekte Familie, von der ich annahm, dass sie irgendwo da draußen war und darauf wartete, uns zu umarmen.
Jahre später, als keine solche Familie entstanden war und meine Enttäuschung drohte, mich zu überholen, drehte ich meine Strategie um 180 Grad. Ich entschied, dass der einzige Weg zum Überleben darin bestand, meine Fantasie für immer aufzugeben. Ich hörte auf, den Horizont zu beobachten; niemand kam, um mich zu retten. Als ich aus dem Pflegesystem ausstieg, schwor ich mir, mir ein solides, verlässlich gutes Leben zu schaffen. Ich würde die Mutter werden, die mir endlos verweigert wurde, liebevoll und liebenswert, bereit zu küssen und zu verbinden, zu stärken und zu ermutigen.
was tun mit übrig gebliebenen nudeln
Leichter gesagt als getan. In den 17 Jahren, in denen ich Schürzenbänder geschwungen habe, wurde ich an vielen Stellen durch meine Vergangenheit geschult. Eltern zu werden, ohne positive Vorbilder gehabt zu haben, ist schwieriger als ich es mir vorgestellt habe. Natürlich hatte ich sozusagen andere Typen von Modellen: Eine Pflegemutter war kalt und kontrollierend und rührte mich nie an, wenn sie es verhindern konnte. Ein anderer war überfordert und meist abwesend. Ein dritter wollte wirklich ein Baby, gurrend und gurgelnd und kostbar, kein schockiertes Schulmädchen. Wenn ich auf meine Kindheit zurückblicke, empfinde ich es als Kriegsdienst, die Zeit im Schützengraben. Nicht alle von mir haben es lebend herausgeschafft.
Meine tückischste Zeit als Elternteil war das erste oder zweite Jahr, die Rookie-Phase, als ich nicht wusste, wie viel Drehmoment meine Geschichte ausüben kann. Ich war 27, als mein Sohn Connor geboren wurde. Alt genug, dachte ich. Älter als meine Mutter war, als sie es von mir wegzog. Außerdem war ich nicht sie. In meiner ersten Ehe sicher und wohlbehalten (so glaubte ich zumindest) hatte ich ein gut gefiedertes Nest. Alle Babybücher wurden indiziert und mit Querverweisen versehen. Ich dachte, ich wäre bereit.
Das praktische Geschäft der Elternschaft war nicht das Problem. Connor war ein guter Säugling. Er schlief gut, gestillt wie ein Weltmeister, spritzte hinreißend in seiner Badewanne. Eines Nachmittags schoss ich ein Foto von ihm in seiner Wiege, wie er in einem Strampler mit roten und blauen Sternen auf der Brust ein Nickerchen machte, die Knie zum Bauch gezogen, den Daumen an seiner perfekten Nase kuschelnd. Dieses Bild bricht mir das Herz. Gegenwart. Es bricht mir jetzt das Herz. Damals habe ich nicht viel gespürt, als ich meinen Sohn ansah. Oder mein Mann oder der Fernseher oder die Glühwürmchen, die in einer Sommernacht durch meinen Garten streifen. Ich hatte erwartet, mich von mütterlicher Liebe und Zufriedenheit überflutet zu fühlen. Stattdessen fühlte ich mich leer und traurig.
Sie haben einen Fall von Babyblues, sagte mein Geburtshelfer, als ich bei einer Untersuchung auseinanderfiel. Sie sagte mir, ich solle mich mehr ausruhen und ihr Büro anrufen, wenn ich glaube, dass ich Medikamente brauche. Vielleicht hätte ich sie anrufen sollen; Ich bin mir immer noch nicht sicher. Postpartale Depressionen waren höchstwahrscheinlich ein Teil dessen, was mit mir los war – aber es gab noch ein weiteres Puzzleteil, das wenig mit Hormonen zu tun hatte.
Als ich meinen Sohn ansah, der völlig auf mich angewiesen war, um alle seine Bedürfnisse zu befriedigen, wurde ich plötzlich mit dem Weggang meiner Mutter konfrontiert. Der Gedanke, der mir ständig durch den Kopf ging, war kein intellektueller, sondern eindringlicher und roher: Ich war ihr Baby gewesen. Sie hatte mich gehalten und gefüttert und angezogen – und sie hatte mich trotzdem verlassen.
Ich hatte mich mit diesen Gefühlen nie abgefunden. Ich habe nicht um meine Mutter geweint, als ich ein Mädchen war, und ich kann mich nicht erinnern, sie zu vermissen. Keine meiner Schwestern hat jemals ihren Namen erwähnt. Es war, als hätten wir sie getrennt und gemeinsam gelöscht. Selbst als ich im vollen Fantasy-Modus war und mir die Familie vorstellte, die mich retten würde, trat meine Mutter nie als Nebenfigur auf – und ich habe mir sicherlich nie vorgestellt, dass sie für mich zurückkommt. Vielleicht hatte ich schon erkannt, dass sie sich nie genug zusammenreißen würde, um zurückzukehren. Oder vielleicht wollte ich, dass sie so heftig und vollständig zurückkehrte, dass ich es nicht ertragen konnte, es mir zu wünschen.
Mit 27 verstand ich nicht, inwieweit ich immer noch ein verängstigtes kleines Mädchen war, das einen Müllsack umklammerte – ich wusste nur, dass ich damit nicht umgehen konnte. Ich wollte eine perfekte Mutter sein und meinem Sohn eine makellose Kindheit ermöglichen, aber dieser Druck wurde lähmend. Wenn ich zum Beispiel die Geduld verlor oder ihn nicht sofort beruhigen konnte, fühlte ich mich wie ein Versager. Meine Launen schwankten an jedem beliebigen Tag wild. Obwohl mein Mann anfangs verständnisvoll war, wurde er schließlich besorgt, dann ungeduldig, dann wütend. Er hatte sich nicht für eine mürrische und kaum funktionierende Frau angemeldet. Er wollte, dass ich zu meinem normalen Selbst zurückkehre. Das Problem: Ich hatte keine Ahnung, wer das war.
Zuerst zog ich auf die Couch, dann in das Haus eines Freundes, und dann ging ich für immer und nahm Connor – inzwischen ein Kleinkind – mit in eine ein paar Stunden entfernte Stadt, wo ich die Graduiertenschule besuchte. Wir lebten von Studentendarlehen in knochigen Familienhäusern aus Betonblöcken. Meine Tage waren ein Rauschen von Makkaroni und Käse und Hot Wheels, mitten in einer Hausarbeit über den Dichter Wallace Stevens innezuhalten, um über die Namen von Pokémon befragt zu werden oder Transformers in den Bestienmodus zu ringen.
Der Umzug und die neuen Herausforderungen halfen mir für kurze Zeit aus meiner Depression, aber mein verbesserter Geisteszustand hielt nicht an. Connor und ich sahen nicht wie die Traumfamilie aus, die in meiner Kindheit so viel Gewicht gehabt hatte. Dieses Bild war jetzt noch mächtiger, da ich befürchtete, meine Entscheidungen würden mich immer weiter davon wegführen. Wie konnte ich Connor eine glückliche Kindheit schenken, wenn mein eigenes Glück nie in Reichweite war?
Ich fing an, ganze Nachmittage im Badezimmer zu weinen. Während Werbe- oder Legopausen kam Connor zur Tür und klopfte leicht. Worüber machst du dir Sorgen, Mama? Ich schluchzte stärker. Ich hatte keine Worte dafür, wie ich mich fühlte. Aber ich befürchtete, dass ich ein hoffnungsloses Knurren aus unserem Leben mache. Dass, egal was ich tat, Connor und ich würden wieder dort landen, wo ich angefangen hatte, in einer Landschaft voller Chaos und Verzweiflung.
Wenn ich zurückblicke, kann ich sehen, dass ich Connor nichts Wichtiges vorenthalten habe; er wurde geliebt und gepflegt. Doch damals drohten mich meine Erwartungen wie eine kommende Lawine zu stürzen. Es war nicht genug, dass mein Sohn gut ernährt und behütet war. Ich wollte Utopia direkt, direkt aus dem Paket. Bis es soweit war, würde ich mich vor der nagenden Sorge nicht sicher fühlen, eines Tages meine Mutter zu werden und all ihre Fehler zu wiederholen.
Ein paar Monate später standen Connor und ich in einer Durchfahrtsschlange und warteten darauf, heiße Eisbecher zu bestellen, das Auto war warm und im Leerlauf, als leichter Schnee fiel. Ich schaute über den Parkplatz zu einer Drogerie und dachte daran, eine große Flasche Aspirin zu kaufen und mich umzubringen. Der Drang kam unblutig, ohne jegliche Emotionen, und das machte mir am meisten Angst. Ich wollte nicht sterben. Und ich konnte Connor nicht ohne Mutter verlassen.
Ich bat um Hilfe, ein echter Aufbruch für mich. Ich rief Freunde an, bis ich den Namen eines guten Therapeuten bekam, und dann begann ich, die schmerzhaften Schichten zu lösen und zum ersten Mal um meine Mädchenzeit zu trauern. Mutter zu werden hatte kaum verheilte Wunden wieder geöffnet und mich zurück in das Trauma meiner frühen Jahre gestürzt. Kein Wunder, dass ich mich so gebrochen fühlte – das war ich.
Leider macht Sie auch die beste Therapie nicht so gut wie neu. Von Ende 20 bis Ende 30 sah ich, wie sich meine Freunde in Eltern verwandelten und Minivans und Flaschensysteme und Windeltaschen kauften, die alles andere als fliegen zu können schienen. Als Connor ungefähr 10 Jahre alt war (und erstaunlicherweise auch ziemlich gut angepasst zu sein schien), verspürte ich das Verlangen, die Elternschaft noch einmal auszuprobieren.
wie man ein schlafzimmer feng shui arrangiert
Es war keine einfache Sache. Der Teil von mir, der eine Ehe und mehr Kinder wollte, stand im Konflikt mit dem Teil, der durch und durch verängstigt war. Was ist, wenn es so schlimm wird wie beim ersten Mal oder noch schlimmer? Ich dachte. Und dann bin ich trotzdem vorangekommen.
Ich war 38, als ich wieder heiratete, und innerhalb weniger Monate zeichnete ich sorgfältig meine Basaltemperatur auf. Als ich meinem Gynäkologen gegenüber erwähnte, dass ich schwanger werden wollte, zog er eine Augenbraue hoch und fuhr fort, schreckliche Statistiken über die Wahrscheinlichkeit einer Empfängnis in meinem Alter zu liefern. Letztendlich hatte ich Glück – so viel Glück.
2004 kam meine Tochter Fiona inmitten eines Gewitters zur Welt. Draußen wippten Äste und Telefonkabel schwangen wild, aber in unserem Geburtszimmer war es dunkel und still. Auch bei ihrem ersten Atemzug war es still. Sie sah mich mit Augen an, die einer Babyeule gehörten, und ich spürte, wie sich etwas Uraltes veränderte. Sie schien schon alles über mich zu wissen und mit ihren herrlich gewölbten Füßen und den kleinen Muscheln ihrer Ohren zu sagen, dass sie mich so nehmen würde, wie ich bin.
Als mein frischgebackener Mann am nächsten Tag auf einem Feldbett in der Ecke unseres Krankenzimmers schnarchte und meine Babyeule in meinen Armen schlief, sah ich mir ein TV-Special über Aron Ralstons Tortur im Blue John Canyon an. Ich war wie gebannt von seiner Geschichte und fühlte mich ihr seltsam verwandt. Ok, ich war noch nie tagelang unter einem Felsbrocken festgeklemmt oder mir den eigenen Arm amputiert oder an einer Canyonwand abgeseilt. Trotzdem bezog ich mich auf seinen Überlebenswillen. Meine Mutter hatte mich aufgegeben; manchmal hatte ich überlegt, dasselbe zu tun. Aber ich war immer noch hier und pulsierte vor Lebenslust – und meine Familie auch.
Zwei Jahre später, nach weiteren Kartierungen und noch unheilvolleren Statistiken von meinem Gynäkologen, wurde Beckett geboren. Connor war damals 13 Jahre alt, und als ich ihm Beckett reichte und sich ein wenig unter seinem blaugestreiften Krankenhaushut wand, sagte ich: Du hast einen Bruder. Was denkst du darüber?
Seltsam, sagte er. Aber er lächelte.
Haben alle vor 1978 gebauten Häuser Bleifarbe?
Es ist komisch, einen Sohn aufs Töpfchen zu bringen und dem anderen mein Auto zu leihen, aber es ist auch wunderbar. Irgendwie habe ich es geschafft, die Familie zu gründen, die ich immer wollte. Ich musste hart arbeiten, aus Metallschrott bauen und die meiste Zeit wieder zusammenbauen, aber meine Kinder sind drei der bemerkenswertesten Menschen, die ich kenne. Die alten Ängste bedrohen mich in regelmäßigen Abständen, aber ihnen entgegenzutreten hilft, ihre Potenz zu verringern – und meine zu stärken.
Wenn ich Connor frage, woran er sich aus den Jahren erinnere, in denen wir allein waren, erinnert er sich nur an Gutes – an dieses geliebte Spielzeug, dieses Lieblingsbuch, einen Ausflug in den Streichelzoo mit Freunden. Weißt du, typisches magisches Kindheitszeug.
Stell dir das vor.
Paula McLain ist der Autor des neuen Romans Die Pariser Frau , ebenso gut wie Ein Ticket zum Mitfahren . Ihre Memoiren, Wie Familie , handelt davon, in Pflegefamilien aufzuwachsen. Sie lebt mit ihrer Familie in Cleveland.